
Der Sommer kommt und mit ihm Waldbrände und Buschfeuer auf der ganzen Welt. In den Medien werden diese Ereignisse als Katastrophen dargestellt. Doch eigentlich sind sie nur für den Menschen katastrophal und das auch erst, seitdem wir sesshaft geworden sind. Man will eben einen schöne Aussicht genießen, nicht wahr, da baut man sein Haus eben ganz nah an die Natur ran. Oder man muss die Natur in unmittelbarer Nähe einer größeren Stadt erhalten, weil sonst gar keine mehr da wäre. Und wenn es in so einem Wald nahe an besiedeltem Gebiet mal brennt, rückt sofort die Feuerwehr an und es wird gelöscht.
Das ist unnatürlich und schafft Probleme.
Denken wir uns mal zurück in eine Zeit vor der flächendeckenden Besiedlung durch den Menschen. Im trockenen Hochsommer entzündet sich irgendwo in einem Wald ein Haufen trockener Kiefernnadeln. Das Feuer verbreitet sich schnell im Unterholz und zerstört totes Material, das im letzten Herbst angefallen ist. Das geht ziemlich schnell, denn dieses Material ist knochentrocken. Das kennt man vielleicht vom Lagerfeuer – man schmeißt einen uralten, trockenen Ast rein und freut sich, wie schnell er Feuer fängt – und ist dann enttäuscht, dass keiner der dickeren, frischeren Scheite anbrennt. Das Feuer ging einfach zu schnell wieder aus. Und dasselbe passiert in einem naturbelassenen Wald: Altes, Totes verbrennt so schnell, dass frische grüne Pflanzen gar nicht erst Feuer fangen. Neue Pflanzen, die gerade aus dem Boden kommen, kriegen Licht und Luft und fruchtbaren Nährboden. Alles wunderbar. Es sei denn, man löscht alles sofort. Dann kann totes Material sich über Jahrzehnte ansammeln und Pflanzen im Unterholz wachsen immer dichter. Wenn es dann brennt, hat man so viel totes Zeug, dass es eine Weile brennt. Dann hat das Feuer Zeit, auf die dichtgewachsenen Pflanzen im Unterholz überzugreifen, die dann auch so lange brennen, bis das Feuer die großen, älteren Bäume angreifen kann. Und dann haben wir die Katastrophe: Einen gewaltigen, unkontrollierbaren, hausgemachten Waldbrand. Die Brände können extreme Hitze im Boden verursachen, sodass auch in der Erde gelagerte Samen zerstört werden, die einen kurzen Brand überleben würden. So kann sich der Wald nach einem Brand auch nicht mehr von selbst erholen.
Viele Bäume können durch eine dicke Rinde Feuern standhalten. Ein Beispiel ist die nordamerikanische Gelbkiefer, deren Rinde bis zu 5 cm dick ist. Außerdem stehen diese Bäume unter natürlichen Bedingungen weit auseinander, sodass ein Feuer nicht vom Baum zu Baum übergreifen kann. Wer sich heimische Kiefern schon einmal genauer angeschaut hat, dem sind vielleicht die sehr hohen Kronen aufgefallen. Kiefern haben keine Äste am Stamm, wie andere Nadelbäume. Ein durch das Unterholz fegende Feuer kann so einer Kiefernkrone also nichts anhaben. In bewirtschafteten Wäldern werden Bäume so dicht wie möglich nebeneinander gepflanzt, um die Holzerträge zu erhöhen. Hier hat ein Feuer leichtes Spiel, da es von Baumkrone zu Baumkrone springen kann. In Nordamerika bemüht man sich jetzt, auch Wirtschaftswälder wieder weniger dicht zu pflanzen, um die Feuergefahr zu verringern.
Ein Feuer überstehen ist ja ganz nett. Viel interessanter finde ich ja die Pflanzen, die Feuer brauchen, um sich z.B. fortpflanzen zu können. Und dann sind da noch die Pflanzen, die Feuer verursachen. Absichtlich.
In der ersten Gruppe, den sogenannten Pyrophyten (zu dt. etwa „Feuerpflanzen“) finden wir zum Beispiel die immergrünen Banksien in Australien. Sie haben sehr harte hölzerne Fruchtstände, die von Harz verschlossen sind. Dieses Harz braucht die Hitze eines Feuers, um zu schmelzen und die Samen freizugeben. Damit sie jedoch nicht sofort herausfallen und verbrennen, ist der Samen zusätzlich von einer Hülle umgeben, die den Samen im geöffneten Fruchtstand festhält. Wenn das Feuer vorüber ist, lässt Feuchtigkeit (z.B. Tau oder Regen) die Hülle anschwellen, wodurch sie sich öffnet und der Samen herausfällt. Da das Feuer die Unterholz-Vegetation zerstört hat, fällt der Samen auf fruchtbaren Boden und hat genug Licht. Ein Meisterstück der Evolution!
Auch die insektenfressende Venusfliegenfalle benötigt regelmäßige Brände, und zwar für ihr nacktes Überleben. Sie ist recht klein und wächst dicht am Boden. Außerdem besitzt sie unterirdische Rhizome, das sind so eine Art unterirdische Triebe, aus denen Blätter und ganze Pflanzen wachsen können. Im Garten hat man das Vielleicht bei Maiglöckchen oder Schwertlilien schon mal gesehen. Ingwer ist auch ein Rhizom (also der Teil, den man essen kann). Nach einem Feuer kann die Venusfliegenfalle aus ihren Rhizomen wieder austreiben und hat reichlich Licht, da alle anderen Pflanzen ja verbrannt sind. Passiert das nicht regelmäßig, wird die Venusfliegenfalle überwuchert und stirbt.
Die Samen vieler Pflanzen in Ökosystem, wo es hin und wieder brennt, warten im Boden auf ein Feuer, bevor sie auskeimen. Die Hitze verursacht ein chemisches Signal im Samen, das den Keimvorgang startet.
Und jetzt die ganz schlimmen – die Zündelfritzen unter den Pflanzen. Da wäre die aus Kalifornien stammende Strauchige Scheinheide (Adenostoma fasciculatum), deren Blätter mit brennbarem Öl überzogen sind. Wenn es da anfängt zu brennen, sorgt die Scheinheide dafür, dass das Feuerchen auch ja nicht wieder ausgeht und ordentlich an Größe gewinnt. Die Pflanze selbst verbrennt zwar, treibt aber aus unterirdischen oder nahe am Boden gelegenen überlebenden Trieben schnell wieder aus – und hat die Konkurrenz mal eben vernichtet. Dictamnus Albus, der Aschwurz, ist eine Blütenpflanze, die etwa 120 cm hoch werden kann und wegen ihrer schönen Blüten und ihrem angenehmen zitronig-vanilligem Geruch gerne in Gärten kultiviert wird. Der Wohlgeruch stammt allerdings von ätherischen Ölen, die die Pflanze im Sommer in derartigen Mengen produziert, dass sie regelrecht von den Blättern tropfen. Solche Öle sind dummerweise leicht entzündlich. Wenn so ein Öltropfen an einem heißen Tag das Sonnenlicht fokussiert wie eine Lupe, kann die Pflanze schon mal kurz in Flammen aufgehen. Das Öl verbrennt jedoch so schnell, dass die Pflanze keinen Schaden nimmt. Ob diese spontane Selbstentzündung Absicht ist oder ein Nebeneffekt der Duftproduktion, ist nicht geklärt. Wer mal im Mittelmeerraum unterwegs ist und eine Aschwurz entdeckt, kann mal eben ein Streichholz unter die Blüte halten – und dann nichts wie weg!
Fazit: Waldbrände sind, im Abstand von 10 bis 30 Jahren, normal und sogar nützlich. Pflanzenbestände und die Tiere, die von ihnen leben, brauchen sie. Doch leider ist es aufgrund des dichten Nebeneinanders von Menschen und Wald selten möglich, der Natur ihren Lauf zu lassen. Die Bilder von gigantischen Flammen, die hundert Meter in den Himmel schlagen werden also so bald nicht aus den Medien verschwinden.
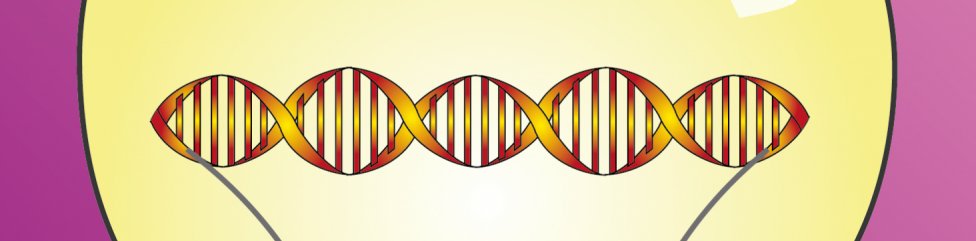




 Wenn man das Wort „Panda“ bei YouTube eingibt, bekommt man 5.480.000 Ergebnisse. Das ist deutlich weniger als wenn man die Worte „cat“, „dog“ oder „tiger“ eingibt. (Nur so nebenbei: Ich wollte eigentlich recherchieren. Nachdem ich eine halbe Stunden lang Katzenvideos geschaut hatte, fiel mir plötzlich wieder ein, dass ich ja noch einen Blogpost schreiben wollte…). Allerdings wurde das
Wenn man das Wort „Panda“ bei YouTube eingibt, bekommt man 5.480.000 Ergebnisse. Das ist deutlich weniger als wenn man die Worte „cat“, „dog“ oder „tiger“ eingibt. (Nur so nebenbei: Ich wollte eigentlich recherchieren. Nachdem ich eine halbe Stunden lang Katzenvideos geschaut hatte, fiel mir plötzlich wieder ein, dass ich ja noch einen Blogpost schreiben wollte…). Allerdings wurde das 

![By Ahodges7 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Manatee_at_Sea_World_Orlando_Mar_10.JPG/800px-Manatee_at_Sea_World_Orlando_Mar_10.JPG) Forscher der Abteilung Geologie und Umwelt an der amerikanischen Stanford University haben gemeinsam mit Mathematikern des Swarthmore College USA herausgefunden, dass marine Lebewesen auf unserem Planeten immer größer werden. Dazu haben sie Fossilien und maßstabsgetreue Fotos von Tieren vermessen und so die Körpergrößen von 75 % der Arten von Meerestieren die in den letzten 542 Millionen Jahren lebten ermittelt. Das ist ziemlich gründlich. Und so darf man den Forschern glauben schenken, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass Meerestiere im Laufe der Evolution immer größer geworden sind. Die statistische Auswertung der Daten hat ergeben, dass dies kein Zufall ist, sondern gerichtete Selektion. Das heißt, dass die größeren Tiere einer bestimmten Art sich öfter fortpflanzen und die Gene für ihre Körpergröße damit öfter weitergegeben werden als die Gene für geringere Größe. Doch warum können diese Tiere sich öfter fortpflanzen? Noel A. Heim und seine Kollegen, die diese Ergebnisse heute in der Zeitschrift Science veröffentlicht haben, führen es darauf zurück, dass größere Tiere zum einen erfolgreicher sind bei der Nahrungssuche und der Partnerwerbung, weil sie schlicht stärker sind als ihre kleineren Artgenossen. Eine größere Rolle scheint jedoch zu spielen, dass größere Tiere weiter schwimmen können und daher Nahrung und Partner in einem größeren Umkreis finden. Und noch etwas: Vielleicht ist dem einen oder anderen gerade schon durch den Kopf gegangen, dass die meisten größten Meerestiere Säugetiere sind – Wale, Walrosse und Seekühe zum Beispiel. Sie alle müssen auftauchen um Luft zu holen. Das scheint zunächst ein Nachteil zu sein, doch der Sauerstoffgehalt der Luft ist etwa 25 mal höher als der im Wasser, Luft „fließt“ viel schneller als Wasser durch die Atmungsorgane und die Aufnahme des Sauerstoffs ins Blut aus der Luft ist 300.000 mal schneller als aus dem Wasser. Dreihunderttausend! Das macht den Stoffwechsel eines Luftatmers viel effizienter als den eines Wasseratmers und gibt marinen Säugetieren damit die Möglichkeit, sehr groß zu werden.
Forscher der Abteilung Geologie und Umwelt an der amerikanischen Stanford University haben gemeinsam mit Mathematikern des Swarthmore College USA herausgefunden, dass marine Lebewesen auf unserem Planeten immer größer werden. Dazu haben sie Fossilien und maßstabsgetreue Fotos von Tieren vermessen und so die Körpergrößen von 75 % der Arten von Meerestieren die in den letzten 542 Millionen Jahren lebten ermittelt. Das ist ziemlich gründlich. Und so darf man den Forschern glauben schenken, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass Meerestiere im Laufe der Evolution immer größer geworden sind. Die statistische Auswertung der Daten hat ergeben, dass dies kein Zufall ist, sondern gerichtete Selektion. Das heißt, dass die größeren Tiere einer bestimmten Art sich öfter fortpflanzen und die Gene für ihre Körpergröße damit öfter weitergegeben werden als die Gene für geringere Größe. Doch warum können diese Tiere sich öfter fortpflanzen? Noel A. Heim und seine Kollegen, die diese Ergebnisse heute in der Zeitschrift Science veröffentlicht haben, führen es darauf zurück, dass größere Tiere zum einen erfolgreicher sind bei der Nahrungssuche und der Partnerwerbung, weil sie schlicht stärker sind als ihre kleineren Artgenossen. Eine größere Rolle scheint jedoch zu spielen, dass größere Tiere weiter schwimmen können und daher Nahrung und Partner in einem größeren Umkreis finden. Und noch etwas: Vielleicht ist dem einen oder anderen gerade schon durch den Kopf gegangen, dass die meisten größten Meerestiere Säugetiere sind – Wale, Walrosse und Seekühe zum Beispiel. Sie alle müssen auftauchen um Luft zu holen. Das scheint zunächst ein Nachteil zu sein, doch der Sauerstoffgehalt der Luft ist etwa 25 mal höher als der im Wasser, Luft „fließt“ viel schneller als Wasser durch die Atmungsorgane und die Aufnahme des Sauerstoffs ins Blut aus der Luft ist 300.000 mal schneller als aus dem Wasser. Dreihunderttausend! Das macht den Stoffwechsel eines Luftatmers viel effizienter als den eines Wasseratmers und gibt marinen Säugetieren damit die Möglichkeit, sehr groß zu werden. Wir haben ein Problem und es wird schlimmer – multiresistente Bakterien. In den Nachrichten hört man immer wieder davon, sie werden „multiresistente Keime/ Erreger“, manchmal auch „multiresistente Krankenhauskeime“ genannt. Dabei handelt es sich um Bakterien, die nicht mehr durch Antibiotika bekämpft werden können. Solche Bakterien können sich zum Beispiel in offenen Wunden ansiedeln und deren Heilung verhindern. Auch unter Erregern von Tuberkulose, Durchfall und Lungenentzündung sind bereits multiresistente Erreger (MRE) aufgetaucht. Besonders häufig hört man dieser Tage von Pseudomonas aeruginosa, einem Krankenhauskeim, der 10 % aller Krankenhausinfektionen verursacht. Dieses Stäbchenbakterium ruft unter anderem Harnwegsinfektionen, Dickdarm- oder Hirnhautentzündungen hervor. Besonders Menschen mit schwachem Immunsystem, z.B. Kinder und ältere Leute oder Menschen mit Vorerkrankungen sind anfällig für die Infektion mit einem solchen MRE. Doch wie konnte es dazu kommen, dass Bakterien immun sind gegen fast jedes bekannte Antibiotikum? Und was können wir auf lange Sicht dagegen tun?
Wir haben ein Problem und es wird schlimmer – multiresistente Bakterien. In den Nachrichten hört man immer wieder davon, sie werden „multiresistente Keime/ Erreger“, manchmal auch „multiresistente Krankenhauskeime“ genannt. Dabei handelt es sich um Bakterien, die nicht mehr durch Antibiotika bekämpft werden können. Solche Bakterien können sich zum Beispiel in offenen Wunden ansiedeln und deren Heilung verhindern. Auch unter Erregern von Tuberkulose, Durchfall und Lungenentzündung sind bereits multiresistente Erreger (MRE) aufgetaucht. Besonders häufig hört man dieser Tage von Pseudomonas aeruginosa, einem Krankenhauskeim, der 10 % aller Krankenhausinfektionen verursacht. Dieses Stäbchenbakterium ruft unter anderem Harnwegsinfektionen, Dickdarm- oder Hirnhautentzündungen hervor. Besonders Menschen mit schwachem Immunsystem, z.B. Kinder und ältere Leute oder Menschen mit Vorerkrankungen sind anfällig für die Infektion mit einem solchen MRE. Doch wie konnte es dazu kommen, dass Bakterien immun sind gegen fast jedes bekannte Antibiotikum? Und was können wir auf lange Sicht dagegen tun? Ich liebe The Big Bang Theory. Aber der gezeigte Umgang von Wissenschaftlern untereinander basiert auf einer hoffnungslos veralteten Etikette. Wenn promovierte Wissenschaftler, also Leute mit Doktortitel, einander begrüßen oder vorstellen, sagt man den Doktortitel nicht mit dazu. Und wir duzen uns alle und sprechen uns mit dem Vornamen an. Erstens ist das einfacher so und zweitens ist die Sprache der Wissenschaft Englisch, und da gibt es kein „Sie“. Außerdem kann man bei uns nicht mit dem Doktortitel protzen, weil jeder einen hat. So ist das in den Naturwissenschaften. Merkwürdige Welt, wirklich.
Ich liebe The Big Bang Theory. Aber der gezeigte Umgang von Wissenschaftlern untereinander basiert auf einer hoffnungslos veralteten Etikette. Wenn promovierte Wissenschaftler, also Leute mit Doktortitel, einander begrüßen oder vorstellen, sagt man den Doktortitel nicht mit dazu. Und wir duzen uns alle und sprechen uns mit dem Vornamen an. Erstens ist das einfacher so und zweitens ist die Sprache der Wissenschaft Englisch, und da gibt es kein „Sie“. Außerdem kann man bei uns nicht mit dem Doktortitel protzen, weil jeder einen hat. So ist das in den Naturwissenschaften. Merkwürdige Welt, wirklich.